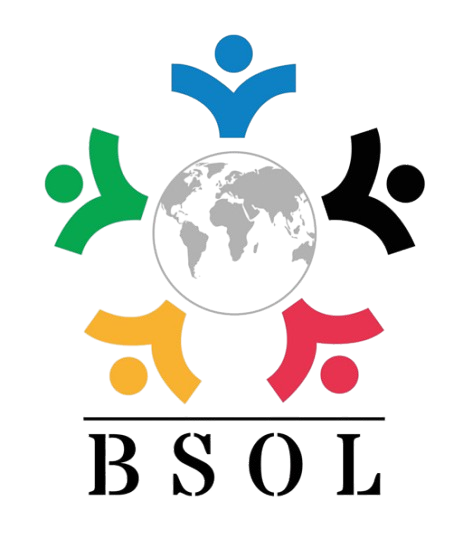Lesezeit: 6 min.
Schwester Maria Troncatti, Tochter Mariens, Hilfe der Christen, am 19. Oktober 2025 heiliggesprochen, lebte ihr Leben, indem sie ihre Hände flehend und ergeben dem Herrn entgegenstreckte und sie dem Nächsten als Zeichen der Hilfe, des Trostes und der Heilung entgegenhielt. Sie war eine Missionarin des Evangeliums, verkündete das Reich Gottes, heilte die Kranken, zog von Dorf zu Dorf und wirkte Heilungen des Körpers und der Seele. Die Hände von Schwester Maria waren Hände, die aufnahmen, halfen, heilten und segneten.
Hände, die pflegen und heilen
Welch ein Fest und zugleich welch ein großer Schrecken war die erste Begegnung mit den Shuar-Indianern auf dem Weg nach Macas, mitten im ecuadorianischen Amazonas-Regenwald, vor hundert Jahren, nach einer über einen Monat dauernden Reise voller Gefahren und Schwierigkeiten. Der Empfang war an einen Geleitbrief gebunden, dessen Fehlen weder eine Verschiebung noch eine erzwungene Rückführung vorsah, sondern nur eine pauschale Hinrichtung. Eine jugendliche Tochter des Kaziken, des Stammesführers, war einige Tage zuvor versehentlich von einer Gewehrkugel getroffen worden, aufgrund einer Rivalität zwischen verfeindeten Familien. Die Wunde eiterte bereits. Der hinzugezogene Medizinmann hatte sich geweigert, die Behandlung durchzuführen, und der Fall war ernst. Da man wusste, dass sich unter den Missionaren eine „Ärztin“ befand, wurde ohne viele Vorreden die Alternative gestellt: „Wenn du sie heilst, nehmen wir dich auf; wenn sie stirbt, töten wir dich“. Eine bedeutsame Geste zeigte, dass dasselbe Schicksal den anderen der Gruppe vorbehalten war. Inzwischen bewachten einige Krieger, wie „Rachestatuen“, die kleine Mission. Alle blickten Schwester Maria flehend an. Der Häuptling öffnete die Tür, das Mädchen wurde hereingebracht und auf einen Tisch gelegt. „Schwester Maria, operieren Sie sie“, sagte Msgr. Domenico Comin, Apostolischer Vikar. „Ich bin keine Ärztin, Monsignore; und womit denn, mit welchen Instrumenten?“ „Wir alle werden beten, während Sie operieren“, beharrte die Inspektorin Mutter Mioletti. Auch das Mädchen sah sie an. Schwester Maria legte ihr eine Hand auf die Stirn: Sie war heiß. Die Missionarin bat darum, Wasser zu kochen, bedeckte sich mit einem weißen Tuch und ging mit Hilfe von Jodtinktur und einem Taschenmesser, das sorgfältig über der Flamme sterilisiert worden war, zu einem entschlossenen Schnitt über, während sie innerlich die Helferin anrief, während die Missionare in der Kapelle beteten. Wie von einer unbekannten Hand gestoßen, sprang die Kugel heraus und fiel zu Boden, unter dem unkontrollierten Gelächter der Kivari, die ihre Zufriedenheit ausdrückten. „Die Madonna hat mir geholfen“, schrieb Schwester Maria; „ich habe ein Wunder gesehen: Ich konnte die Kugel entfernen und das Kind wurde gesund, dank Maria der Helferin und Mutter Mazzarello“. So eröffnete sich ihr das weite Feld der Mission, wobei sie den Beginn ihres Werkes der mütterlichen Fürsprache der Helferin zuschrieb: Sie heilte ein kleines Mädchen als Erstlingsfrucht und Zeichen dafür, dass sich Schwester Maria und ihre salesianischen Mitschwestern besonders für den Schutz und die Förderung des Lebens und der Entwicklung von Mädchen und jungen Frauen einsetzen werden.
Betende Hände
Sie begleitete die Seelenführung mit dem Rosenkranz in der Hand und opferte die Geheimnisse des Leidens Christi, seiner Freuden und seiner Triumphe für diejenigen, die sich ihr näherten. Ihre Fürsorge verstand es, neben dem medizinischen Problem auch den Lebens- und Familienkontext zu erfassen, denn „sie konnte niemanden leiden sehen. Sie unternahm alle Anstrengungen, um jede Schwierigkeit zu lösen und jeden in Frieden zu lassen“. Das letztendliche Ziel war klar: alle zu Gott zu führen oder wieder näher zu ihm zu bringen. „Mit dem Rosenkranz in der Hand löste sie schwierige Fälle, sowohl materielle, wie die Heilung von Kranken, als auch schwierige wirtschaftliche Situationen, sowie spirituelle: die Wiederherstellung geteilter Familien, die Rückkehr zur Freundschaft mit Gott derer, die jahrelang von ihm entfernt waren“. Ihr „botiquín“ wurde so zur Ambulanz für die Seelen. „Als sie die Kranken pflegte, interessierte sich Schwester Maria sehr für ihr religiös-moralisches Leben und für die Probleme jedes Einzelnen und der Familie. Sie wusste zu orientieren und zu animieren, sie wusste klar zu führen und zurechtzuweisen“. Ihre Liebe zu den Kranken war wirklich heldenhaft: Sie ließ alles stehen und liegen und ging zu jeder Tages- und Nachtzeit, bei schönem oder schlechtem Wetter, wohin sie gerufen wurde, mit einem Stock in der einen Hand und einem Rosenkranz in der anderen, und sie hatte keine Ruhe, bis sie den Gesundheitszustand des Kranken verbessern oder ihm helfen konnte, gut zu sterben.
Wundersame Hände
Ein schrecklich verbrannter und vor Schmerz wahnsinniger Mann wird von Schwester Maria so behandelt: Zwei Tage und zwei Nächte beginnt sie die Behandlung mit dem Rosenkranz und pflegt ihn einige Wochen lang. Nach dreißig Tagen erfüllt dieser Mann mit seiner Frau das Gelübde, das er der Jungfrau Purísima von Macas abgelegt hatte: Er ist völlig gesund, ohne jegliche Anzeichen oder Narben auf der Haut. Niemand hätte geglaubt, dass er diese Prüfung überleben könnte. Gott heilte ihn durch die wundersamen Hände, die täglichen Gebete und das mütterliche Herz von Schwester Maria. Ihr Eifer wird durch dieses Urteil gut beschrieben: „heldenhaft in der Ausübung der Nächstenliebe. Sie scheute weder Opfer noch Gefahren noch Ansteckungen; noch weniger ließ sie sich von widrigen Wetterphänomenen aufhalten… es genügte zu wissen, dass jemand litt, damit sie ihm zu Hilfe eilte, die Hoffnung im Herzen tragend, Gutes tun zu können, auch ihren Seelen“. Zusammen mit anderen Mitschwestern unternahm sie trotz zahlreicher Gefahren, darunter auch solche durch wilde Tiere im Wald, eine immense Evangelisierungs- und Menschenförderungsarbeit. Die Orte Macas, Sevilla Don Bosco und Sucúa sind noch heute einige der blühenden „Wunder“ ihrer Tätigkeit als Krankenschwester, Chirurgin und Orthopädin, Zahnärztin und Anästhesistin. Aber vor allem war sie Katechetin und Zeugin des Herrn, Verkünderin der Guten Nachricht.
Hände, die das Feuer des Hasses und der Rache löschen
Im Alter von etwa sieben bis acht Jahren befindet sich Maria im Sommer am Col d’Aprica (Sondrio) mit anderen Hirtenkindern, die, nachdem sie ihre Herden zusammengetrieben haben, am Bach spielen. Die Jungen beschließen, nach einem Regenschauer ein kleines Feuer anzuzünden, um sich zu trocknen, doch ein plötzlicher Windstoß treibt die Flamme auf Maria zu, und eine Stichflamme leckt an ihrem Kleidchen und ihren Strümpfen. Erschrocken versucht sie, die Flammen mit den Händen zu löschen; während die Strümpfe an ihren Beinen zu brutzeln scheinen, werden ihre Hände, verbrannt, schwarz und bleiben wie versiegelt. Zufällig eilt ein Mann, der auf dem nahegelegenen Saumpfad vorbeikommt, herbei, löscht das Feuer und ruft, während er versucht, sie mit Öl zu behandeln: „Armes Kind, sie wird ihre Hände nie wieder benutzen können!“. Wenige Stunden später jedoch sind Hände und Arme wieder gesund und schön, ohne jegliche Brandspuren, während die Narben an den Beinen ihr ganzes Leben lang bleiben werden. Es wird ein weiteres Feuer geben, das Marias Leben Troncatti heimsuchen wird: das des Hasses und der Rache, das während ihres missionarischen Abenteuers unter den Shuar und den Siedlern oft aufflammen wird. Ein Feuer, das sie mit dem Öl der Güte zu löschen versuchen wird und am Ende ihres Lebens mit dem ihres eigenen Lebens, das als Opfer dargebracht wird. Und jene Hände, die das Feuer scheinbar nicht mehr zulassen wollte, werden Werkzeuge für das Feuer der Nächstenliebe sein, das so vielen Menschen Linderung, Pflege und Trost spenden wird.
Hände, die sich Gott hingeben
Den Schwestern, die ihr ihre Angst und Furcht vor der Situation in Sucúa, Ecuador, nach dem Brand, der die salesianische Mission im Juli 1969 zerstörte, zum Ausdruck bringen, antwortet sie mit Entschlossenheit und Festigkeit: „Meine Töchter, fürchtet euch nicht und habt keine Angst vor all dem, was geschehen ist; überlassen wir uns den Händen Gottes und beten wir für die Bekehrung der Bösen! Bleibt in Frieden! Vertraut auf die Jungfrau Maria, die Helferin, und ihr werdet sehen, dass diese Angst nicht lange anhalten wird: Sehr bald werden Ruhe und Frieden einkehren! Das versichere ich euch!“. Es sind Abschiedsworte, im Frieden eines ganz hingegebenen Lebens. Sehr bald, nach dem tragischen Tod am 25. August 1969, wurde der Ruf der Heiligkeit zur vox populi. So wiederholten die Leute: „Sie ist wie eine Heilige gestorben“. Und alle wollten noch einmal diese fleißigen und wundersamen Hände berühren. Die Einheimischen fühlten sich verwaist, waren aber überzeugt, in Schwester Maria „eine Beschützerin im Himmel zu haben, weil sie eine Heilige war“.
Diese zuversichtliche und unerschütterliche Hoffnung ließ sie immer in den Händen Gottes leben und trieb sie auch an, denen, die sie mit ihrer mütterlichen Nächstenliebe unterstützte, den Gedanken an die zukünftige Glückseligkeit einzuflößen, die der Vater denen verspricht, die ihn in diesem Leben mit Liebe und Vertrauen suchen. Es war eine Hoffnung, die sich sichtbar auch und nur in ihrem naiven kindlichen Vertrauen auf die göttliche Hilfe manifestierte: Tatsächlich stützte sie das unerschütterliche Streben nach dem Himmel nicht nur in den unvermeidlichen und nicht wenigen Schwierigkeiten, denen sie bei der Erfüllung ihrer Sendung begegnete. Trotz allem ließ dieses Streben sie bedingungslos auf die göttliche Hilfe vertrauen, um viele praktische Probleme zu lösen und die karitativen Aktivitäten der Mission aufrechtzuerhalten, aber darüber hinaus und vor allem erfüllte es ihr Herz mit jenem Frieden und jener Ruhe, die sie auch anderen vermittelte. „Wie ihr Glaube war, so war auch ihre Hoffnung! Man kann von ihr sagen, dass sie gegen jede Hoffnung hoffte. Nichts erschreckte sie, nichts beunruhigte sie: Ihre Hoffnung war grenzenlos. Für Schwester Maria war alles ein Grund, auf Gott und auf die Belohnung zu hoffen, die Er denen gibt, die sich seiner Sache verschrieben haben. Sie fürchtete auch den plötzlichen Tod nicht; im Gegenteil, sie bat Gott darum und betrachtete ihn als Belohnung, denn für sie war Gott ein Vater von unermesslicher Güte und Barmherzigkeit, und in Ihm vertraute sie völlig“.